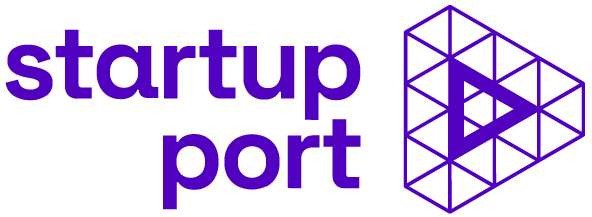Kooperationen zwischen Startups und etablierten Unternehmen gelten als wichtiger Innovationsfaktor für Wachstum und Fortschritt. Sie halten den Wirtschaftsstandort Deutschland wettbewerbsfähig. 87 % der Unternehmen sagen, dass sich Startups zu einem wichtigen Innovationspartner für sie entwickelt haben. Dagegen steht, dass nur 11 % der Startups die Kooperationsbereitschaft von Unternehmen als hoch einschätzen. So lauten zwei der Ergebnisse der Studie „Collaborate to Innovate“ des Bundesverband Deutsche Startups und des Beratungsunternehmens Accenture.
Vertrieb und Innovation als Benefit
Für die Studie wurden Anfang 2025 knapp 500 Unternehmen (360 Startups und 130 etablierte Unternehmen) zu ihren Erfahrungen mit Kooperationsprojekten befragt. Wo liegen die Herausforderungen für beide Seiten und welche Erkenntnisse lassen sich daraus ableiten?
Startups sehen den größten Benefit in den Vertriebsmöglichkeiten, 72%, und der Marktvalidierung, 50%, die sie für ihr Produkt erhalten. In der Zusammenarbeit mit Unternehmen können sie ihr neues Produkt weiterentwickeln, sie erhalten Vertriebskanäle und können skalieren.
Für die Unternehmen ist der größte Treiber für Kollaborationen mit 90 % das Innovationspotenzial, das durch Startups in ihre Unternehmen kommt.
Anzahl Kooperationen rückkläufig
Trotz der Win-Win-Situation für beide Seiten ist der Anteil der Startups, die mit Unternehmen kooperieren, von 72 % im Jahr 2020 auf 62 % in 2024 gesunken. Lag der Anteil erfolgreicher Projekte im Kooperationsprozess bei der Initiierung noch bei 41 %, sind es beim Proof of Concept nur noch 27 %, die Implementierung erreichen 17 % und bis zur Skalierung schaffen es nur 8 % der Kooperationsprojekte.
Der Fokus der Unternehmen richtet sich außerdem zunehmend auf die Scale-Ups (mind. 25 Mitarbeitende), 73 %, welche schnelle Ergebnisse versprechen, und weniger auf Startups, bei denen sich der Ertrag erst mittelfristig erzielen lässt, 57 %.
Touchpoints im Startup-Ökosystem
Dabei hat sich das Ökosystem in Deutschland in den letzten Jahren professionalisiert und bietet mit mehr als 20.000 Gründungen hohes Potenzial für Kooperationen.
Um zusammenzufinden setzen beide Seiten am stärksten auf Veranstaltungen & Konferenzen, 79 % Startups, 80 % Unternehmen. Sich persönlich zu treffen, einen echten Eindruck voneinander zu gewinnen und darüber Vertrauen aufzubauen, wird als besonders wichtig für eine erfolgreiche Zusammenarbeit eingeschätzt.
Aber auch Online-Plattformen – 47 % Startups, 57 % Unternehmen – sowie Netzwerke & Verbände – 66 % Startups, 63 % Unternehmen – werden genutzt. Ein klares Zeichen für das Ökosystem, hier weiterhin ein entsprechendes Angebot bereit zu halten.
Gegensätzliche Kulturen für erfolgreiche Kooperationsprojekte zusammenführen
63 % der Startups befürchten bei einer Zusammenarbeit mit Unternehmen einen Verlust von Geschwindigkeit, 44 % einen Verlust von strategischer Freiheit. Die Herausforderungen liegen für 59 % der Startups in komplexen Entscheidungswegen und für 49 % in der Risikovermeidung bei etablierten Unternehmen.
Die Unternehmen sehen Herausforderung in den begrenzten Ressourcen, 48 %, einer hohen Unsicherheit durch neue Produkte, 35 %, und den hohen Anforderungen an Compliance, 31 %. Nur 28 % erwarten einen Return on Investment aus der Kooperation.
Deshalb ein Fazit der Studie:
Damit gemeinsame Projekte funktionieren, müssen gegensätzliche Unternehmenskulturen und unterschiedliche Bedürfnisse nach Geschwindigkeit und Sicherheit in Einklang gebracht werden. Startups sollten einen Weg finden, Prozesse und Abstimmungswege schlank zu halten, auch wenn sie über die Kooperation einen erhöhten Aufwand an Kommunikation haben. Unternehmen dagegen sollten sich immer wieder bewusst machen, wie entscheidend Innovation für ihre Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit ist.
Das ist auch deshalb wichtig, um die Investitionslücke im Bereich KI, aber auch im Wirtschaftswachstum insgesamt, zwischen Deutschland, 4 % Wachstum seit 2015, und den USA, 17 % Wachstum seit 2015, zu schließen. So eine weitere Erkenntnis der Studie.